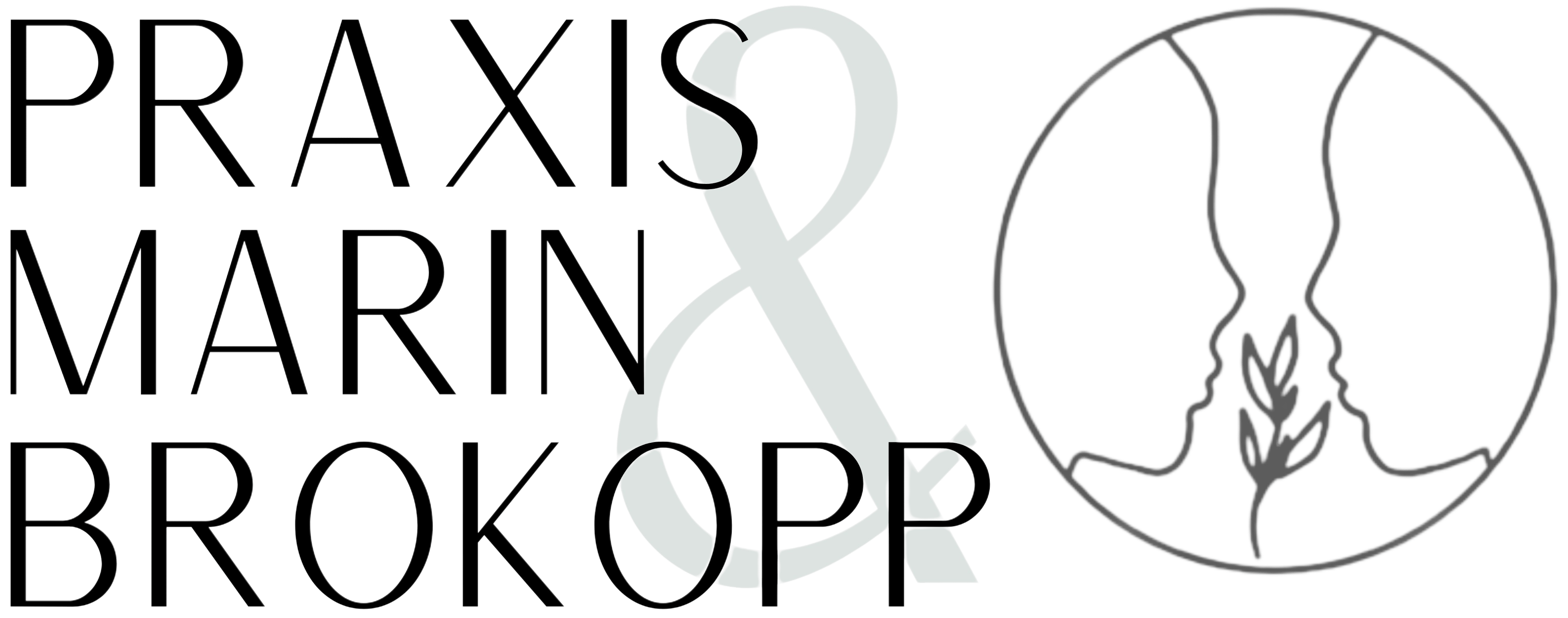Einleitung
„Ich wollte doch nur erklären, warum ich so reagiert habe!“ – Ein Satz, der in zwischenmenschlichen Beziehungen häufig fällt, besonders in Konfliktsituationen. Rechtfertigungen scheinen auf den ersten Blick harmlos. Sie klingen wie ein Versuch, Missverständnisse aufzuklären oder dem anderen die eigene Perspektive näherzubringen. Doch genau darin liegt ihr Trugschluss: Was als Erklärung gemeint ist, wird vom Gegenüber oft als Abwehr, Schuldumkehr oder emotionale Distanzierung erlebt. In diesem Artikel werfen wir einen genauen Blick darauf, was hinter dem Rechtfertigungsreflex steckt, wie er die Kommunikation sabotiert – und wie wir ihn durch achtsame, verbindende Sprache ersetzen können.
Was ist eine Rechtfertigung überhaupt?
Rechtfertigungen sind Kommunikationsversuche, bei denen es darum geht, das eigene Verhalten oder eine Entscheidung nachträglich zu erklären, zu verteidigen oder in ein günstigeres Licht zu rücken. In Beziehungen tritt dies besonders häufig auf, wenn ein Partner sich verletzt, übergangen oder unverstanden fühlt und der andere darauf reagiert – nicht mit Empathie, sondern mit Erklärungen.
Typische Beispiele sind:
- „Ich habe das doch nur gesagt, weil ich so müde war.“
- „Du musst das verstehen, ich hatte einen stressigen Tag.“
- „Ich wollte dich nicht verletzen, du übertreibst einfach.“
Was inhaltlich oft plausibel klingt, ist kommunikativ problematisch. Denn Rechtfertigungen verlagern die Aufmerksamkeit weg vom Gefühl des Gegenübers hin zur eigenen Perspektive. Sie sind – bewusst oder unbewusst – ein Versuch, unangenehme Verantwortung abzuwehren oder das eigene Selbstbild zu schützen.
Der psychologische Hintergrund: Schutzmechanismus mit Nebenwirkungen
Rechtfertigungen haben eine tiefe psychologische Wurzel. Der Mensch ist bestrebt, ein stimmiges Selbstbild aufrechtzuerhalten – zum Beispiel das Bild von sich als liebevoller, reflektierter oder respektvoller Mensch. Wenn das eigene Verhalten damit nicht übereinstimmt (etwa, weil man laut geworden ist oder jemanden verletzt hat), entsteht ein innerer Konflikt. Die Psychologie nennt das kognitive Dissonanz (Festinger, 1957). Eine Möglichkeit, diese Dissonanz zu reduzieren, besteht darin, das Verhalten nachträglich zu erklären oder zu relativieren.
Hinzu kommen frühkindliche Prägungen: Viele Menschen lernen schon in der Kindheit, dass Fehler mit Liebesentzug, Strafe oder Scham verbunden sind. Der Impuls zur Rechtfertigung dient dann als Schutzmechanismus – gegen Kritik, gegen Ablehnung, gegen emotionale Unsicherheit. In Partnerschaften wird dieser Mechanismus reaktiviert, besonders dann, wenn emotionale Verletzlichkeit gefragt wäre.
Doch dieser Schutz hat Nebenwirkungen. Der Partner, der gerade gehört oder gesehen werden möchte, erlebt die Rechtfertigung oft als Ignoranz oder gar Schuldumkehr. Die Folge ist ein Gefühl des Alleinseins, der emotionalen Abwehr – und letztlich der Entfremdung.
Wie Rechtfertigungen Beziehungen untergraben
Rechtfertigungen unterbrechen nicht nur die emotionale Verbindung, sie erzeugen auch subtile Kommunikationsmuster, die Vertrauen langfristig schwächen:
- Sie verlagern den Fokus: Statt das verletzte Gefühl des Gegenübers anzuerkennen, wird der Fokus auf die eigene Absicht oder Belastung gelenkt. Das Gegenüber fühlt sich dadurch nicht gesehen, sondern übergangen.
- Sie erzeugen Frustration und Ohnmacht: Wer sich verletzt zeigt, möchte in der Regel verstanden und emotional abgeholt werden – nicht analysiert oder korrigiert. Rechtfertigungen lösen daher häufig das Gegenteil der beabsichtigten Wirkung aus: Sie verstärken das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden.
- Sie blockieren echte Verletzlichkeit: Wahre Intimität erfordert die Fähigkeit, sich dem anderen auch mit Fehlern oder Unzulänglichkeiten zu zeigen. Rechtfertigungen sind eine Form der Abwehr – sie lassen Nähe nicht zu, sondern halten Distanz.
- Sie können manipulativ wirken: Besonders dann, wenn sie mit unterschwelliger Schuldzuweisung einhergehen („Wenn du nicht so empfindlich wärst…“), wird aus der Rechtfertigung ein instrumenteller Kommunikationsgriff, der die Beziehung toxisch belasten kann.
Warum es uns so schwerfällt, auf Rechtfertigungen zu verzichten
Der Impuls zur Rechtfertigung ist tief verankert. Er speist sich aus einem sozialen und kulturellen Kontext, in dem Fehler selten als Lernchance, sondern häufig als Makel betrachtet werden. In Schule, Beruf und Gesellschaft wird von uns erwartet, „unsere Entscheidungen erklären“ zu können. Verantwortung zu übernehmen, ohne sich zu erklären, erscheint fast schon widersprüchlich.
Zudem erleben viele Menschen emotionale Konflikte als Bedrohung. Anstatt uns in solchen Momenten verletzlich zu zeigen, greifen wir auf das zurück, was sich sicher anfühlt: Erklärungen, Argumente, Logik. Doch Konflikte in Beziehungen sind selten logisch. Sie sind emotional – und brauchen auch eine emotionale Antwort.
Der Reflex zur Rechtfertigung ist also nicht nur ein persönliches Muster, sondern auch ein gesellschaftlich anerzogenes. Ihn zu durchbrechen erfordert nicht nur Bewusstsein, sondern auch Mut zur eigenen Unvollkommenheit.
Wie gelingende Kommunikation stattdessen aussehen kann
Der Weg raus aus dem Rechtfertigungsautomatismus beginnt mit einer inneren Haltung der Verantwortung und des Zuhörens. Es geht darum, nicht zu argumentieren, sondern zu fühlen – nicht zu erklären, sondern zu verbinden. Das bedeutet konkret:
- Zuhören statt reagieren: Wenn der Partner etwas anspricht, das ihn verletzt hat, ist der erste Schritt: annehmen. Ohne sofortige Erklärung. Ohne Gegenrede.
- Validierung der Gefühle: „Ich sehe, dass dich das getroffen hat“ oder „Das tut mir leid, dass das bei dir so angekommen ist.“ Das bedeutet nicht automatisch, dass man im Unrecht ist – sondern nur, dass man den Schmerz des anderen anerkennt.
- Verantwortung übernehmen: Ohne Relativierung. Ohne „aber“. Einfach: „Das war nicht okay von mir. Ich übernehme die Verantwortung.“
- Nachfragen, verstehen wollen: Anstatt sich zu erklären, lieber fragen: „Wie war das für dich?“ oder „Was hat dich am meisten verletzt?“ – das schafft Raum für echte Begegnung.
Diese Formen der Kommunikation schaffen Vertrauen und emotionale Sicherheit. Sie zeigen dem Gegenüber: „Du bist mir wichtig. Nicht nur meine Absicht zählt – sondern wie du dich fühlst.“
Fazit: Weniger erklären, mehr verstehen
Rechtfertigungen sind ein weit verbreitetes, tief verankertes Muster – verständlich, aber nicht hilfreich. Sie entstehen aus dem Wunsch nach Schutz, nach Klarheit, nach Selbstbehauptung. Doch in der Paarkommunikation erreichen sie oft das Gegenteil: Sie erzeugen Distanz, Unverständnis und Frustration.
Echte Verbindung entsteht, wenn wir es wagen, ohne Schutz zu sprechen. Wenn wir dem anderen den Raum geben, sich gesehen zu fühlen – auch (oder gerade dann), wenn wir einen Fehler gemacht haben. Wenn wir unsere Absicht loslassen und die Wirkung anerkennen. Denn nicht das perfekte Argument heilt Beziehungskonflikte – sondern das aufrichtige Mitgefühl.
Literaturverzeichnis
Lerner, Harriet (2004): The Dance of Connection: How to Talk to Someone When You’re Mad, Hurt, Scared, Frustrated, Insulted, Betrayed, or Desperate. HarperCollins.
Festinger, Leon (1957): A Theory of Cognitive Dissonance. Stanford University Press.
Rosenberg, Marshall B. (2003): Gewaltfreie Kommunikation: Eine Sprache des Lebens. Junfermann.
Brown, Brené (2012): The Power of Vulnerability. TEDxHouston / Sounds True.
Schulz von Thun, Friedemann (2000): Miteinander reden 1: Störungen und Klärungen. Allgemeine Psychologie der Kommunikation. Rowohlt.
Neff, Kristin (2011): Self-Compassion: The Proven Power of Being Kind to Yourself. William Morrow.