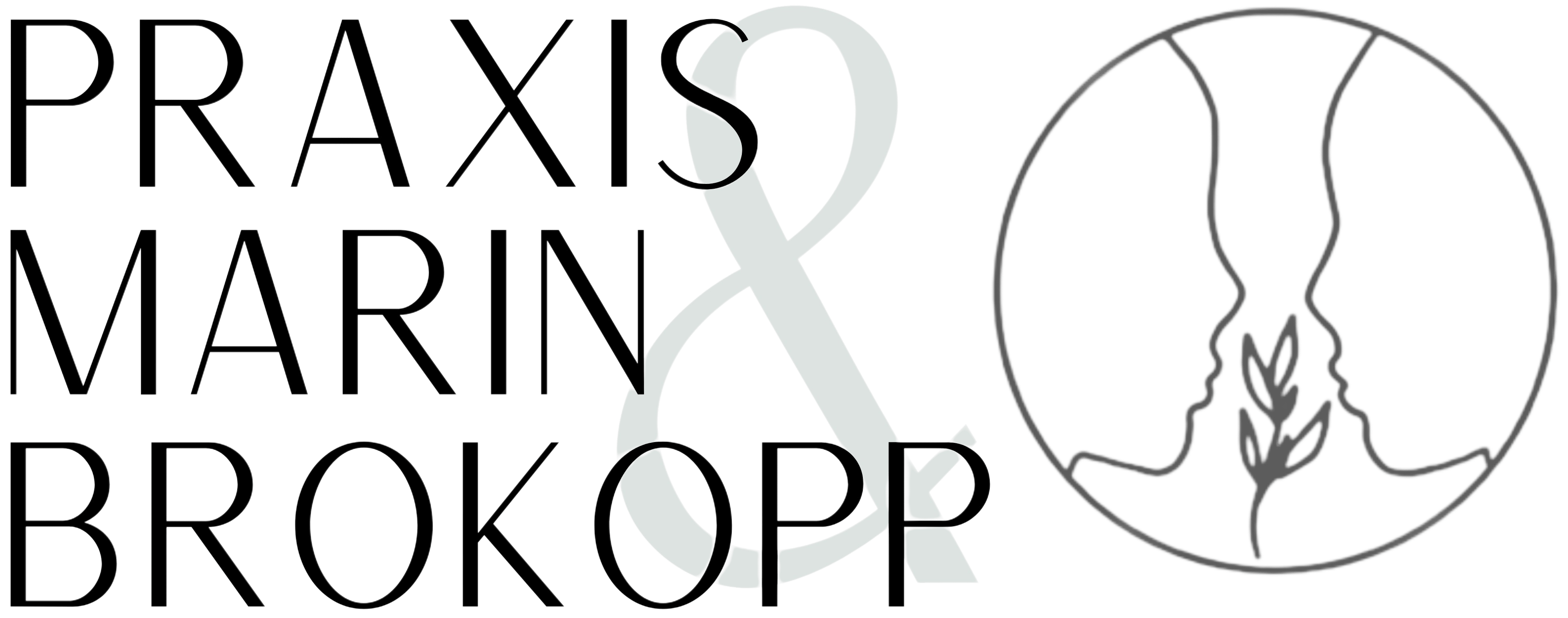Sex ist ein zentraler Bestandteil vieler Partnerschaften – als Ausdruck von Nähe, Begehren,
Intimität und emotionaler Verbundenheit. Gleichzeitig ist sexuelle Unzufriedenheit eines der
Themen, über das Paare am wenigsten offen sprechen. In der Beratung und Therapie zeigt
sich: Viele Menschen leiden still. Sie vermissen Nähe, Lust oder echte Verbindung, aber sie
schweigen – aus Scham, Unsicherheit oder Angst, den Partner zu verletzen. Sexuelle
Unzufriedenheit ist ein Tabuthema, obwohl sie in Beziehungen häufig vorkommt und
tiefgreifende emotionale Auswirkungen haben kann.
Sexuelle Unzufriedenheit zeigt sich in vielen Formen. Manche Menschen erleben ein
plötzliches Nachlassen der Lust, andere spüren über lange Zeit kein sexuelles Verlangen mehr.
Es kann ein Gefühl entstehen, den Erwartungen des Partners nicht zu genügen – oder selbst
ständig zurückzustecken. Auch Unterschiede im Bedürfnis nach Nähe, Frequenz, Fantasie
oder Art des sexuellen Ausdrucks führen nicht selten zu Spannungen. Besonders brisant wird
es, wenn das Thema nicht offen kommuniziert wird. Was im Stillen beginnt, kann sich über
die Zeit zu einem tiefen Graben entwickeln – emotional und körperlich.
Eine zentrale Schwierigkeit liegt in der gesellschaftlichen Aufladung des Themas. Sex gilt in
vielen westlichen Kulturen als Maßstab für Glück, Gesundheit und Liebeserfolg. Paare, die
„guten Sex“ haben, werden medial als Idealbilder inszeniert. Gleichzeitig wird kaum Raum
geschaffen für eine ehrliche Auseinandersetzung mit der Tatsache, dass sexuelle Bedürfnisse
sich verändern, dass sie verletzlich sind – und dass Unzufriedenheit nicht gleichbedeutend mit
Lieblosigkeit sein muss. Wer über sexuelle Frustration spricht, befürchtet oft, die Beziehung
infrage zu stellen oder sich selbst als „schwierig“, „verklemmt“ oder „zu bedürftig“ zu outen.
Dabei ist das Gegenteil der Fall: Über Sexualität zu sprechen, ist Ausdruck von Reife,
Beziehungspflege und Selbstachtung.
Was sind die Ursachen sexueller Unzufriedenheit? Die Forschung zeigt, dass sie selten
monokausal ist. Biologische Faktoren wie Hormonveränderungen (z. B. in der
Schwangerschaft, nach der Geburt, in den Wechseljahren oder durch Stress) können eine
Rolle spielen. Auch Medikamente oder chronische Erkrankungen beeinflussen die Libido.
Weitaus häufiger sind jedoch psychologische und beziehungsdynamische Hintergründe:
Unausgesprochene Konflikte, ungleich verteilte emotionale Verantwortung,
Rollenfestlegungen („Du bist der Bedürftige“, „Ich bin die Abweisende“) oder auch das
Gefühl, im Alltag keinen echten Kontakt mehr zu erleben. In vielen Fällen ist das sexuelle
Problem nur die sichtbare Spitze eines tieferliegenden Beziehungsmusters.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die individuelle sexuelle Biografie. Wer in einem Umfeld
aufgewachsen ist, in dem Sexualität tabuisiert, beschämt oder gar mit Schuld verbunden war,
trägt oft innere Hemmungen mit sich. Diese können sich in der Partnerschaft plötzlich
verstärken – besonders, wenn es an sicheren, offenen Gesprächsräumen fehlt. Auch
Erfahrungen von Missbrauch oder Übergriffigkeit hinterlassen Spuren im Körpergedächtnis
und in der sexuellen Ausdrucksfähigkeit. Hinzu kommt das Thema Leistung: In einer
leistungsorientierten Gesellschaft wird auch Sexualität oft funktionalisiert. Es geht darum,
„gut zu sein“, den anderen zu befriedigen, Erwartungen zu erfüllen – statt um echten Kontakt,
Genuss und das Zulassen von Verletzlichkeit.
In der Paarberatung begegnet man häufig dem Satz: „Eigentlich läuft alles gut – nur im Bett
stimmt es nicht mehr.“ Doch dieser Satz ist trügerisch. Sexualität ist ein Resonanzraum. Sie
spiegelt, wo Nähe gelingt und wo sie brüchig ist. Wenn die körperliche Verbindung stockt, ist das oft ein Hinweis auf emotionale Entfremdung, unausgesprochene Bedürfnisse oder
ungelöste Konflikte. Wer dann den sexuellen Rückzug einfach „akzeptiert“, riskiert eine
schleichende Distanzierung, in der Intimität immer mehr zum Fremdwort wird.
Die gute Nachricht: Sexualität ist veränderbar. Sie ist nicht statisch, kein unveränderlicher
Teil einer Beziehung – sondern ein lebendiger Ausdruck von Begegnung. Paare, die es
schaffen, offen über Wünsche, Ängste, Fantasien und Grenzen zu sprechen, erleben häufig
eine neue Tiefe – auch, wenn es anfangs schwerfällt. Wichtig ist dabei ein geschützter
Rahmen: ein Raum ohne Vorwürfe, ohne Druck, in dem Unsicherheiten ebenso Platz haben
wie Humor, Neugier und Offenheit. In manchen Fällen kann auch eine sexualtherapeutisch
orientierte Beratung hilfreich sein – besonders, wenn sich Themen wie Scham, Abwehr oder
Traumata zeigen.
Ein konstruktiver Umgang mit sexueller Unzufriedenheit bedeutet nicht, dass alles
„funktionieren“ muss. Es bedeutet, dass Nähe möglich wird, auch wenn sie nicht perfekt ist.
Dass Lust nicht als Pflicht, sondern als Dialog verstanden wird. Und dass Partnerschaft ein
Ort sein kann, an dem man gerade über das Schweigen hinweg in Verbindung bleibt.
Sexuelle Unzufriedenheit ist kein Scheitern, sondern eine Einladung – zur Reflexion, zum
Gespräch, zur Veränderung. Wer sie ernst nimmt, kann darin sogar neue Lebendigkeit finden.
Quellen:
- Schnarch, D. (2001). Die Psychologie sexueller Leidenschaft. Kösel Verlag.
- Perel, E. (2006). Mating in Captivity: Unlocking Erotic Intelligence. HarperCollins.
- Basson, R. (2001). Using a different model for female sexual response to address
women’s problematic low sexual desire. Journal of Sex & Marital Therapy, 27(5),
395–403. - Levine, S. B. (2003). The nature of sexual desire: A clinician’s perspective. Archives
of Sexual Behavior, 32(3), 279–285. - Hahlweg, K. (2016). Paartherapie: Grundlagen – Methoden – Praxis. Springer.